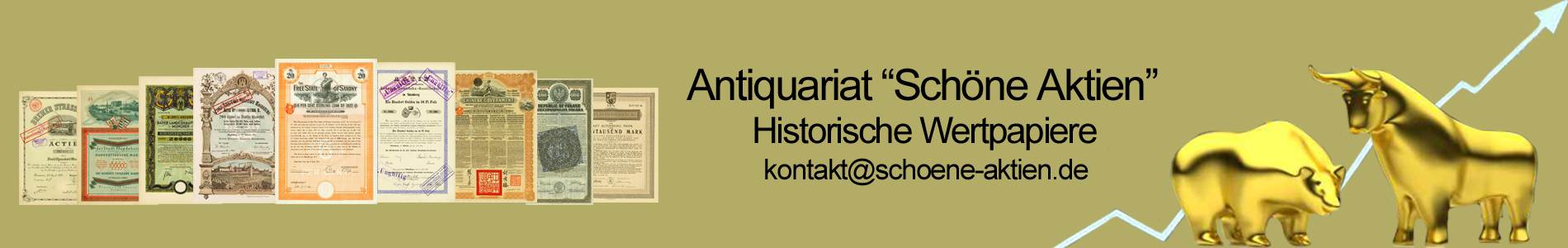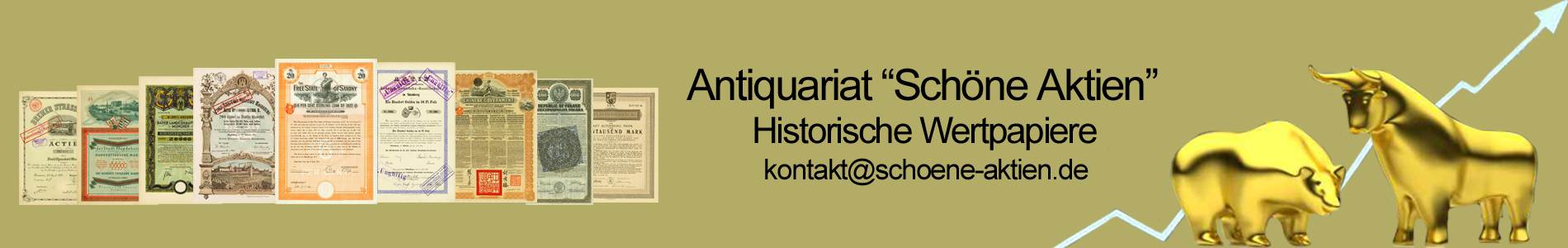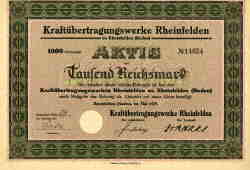
Bestell-Nr.: D318
 Preisliste
Preisliste
|

Bestell-Nr.: D161f
 Bestell-Nr.: D161d
Bestell-Nr.: D161d
 Preisliste
Preisliste
|
Die Kraftübertragungswerk Rheinfelden wurden am 31.Oktober 1894 in
Berlin gegründet.
Unterstützt wurde der Bau des Kraftwerkes am Rhein durch Emil Rathenau
(AEG), Georg von
Siemens (Deutsche Bank) und Carl von Fürstenberg (Berliner Handelsgesellschaft).
|
Während der Planungsphase tat sich einiges auf dem Gebiet des Generatorbaus. Das
ursprüngliche Konzept von Zschokke wurde deshalb überarbeitet und kam mit der Hälfte
der Turbinen und Generatoren aus. Dadurch sanken die Herstellungskosten, auf
6 Millionen
Franken (4.5 Millionen RM). Auch zwei Schweizer Chemieunternehmen beteiligten sich
am Bau.
Damit war die Finanzierung und Stromabnahme gesichert.
Das rechte Rheinufer gehörte zu Deutschland, das linke zur Schweiz - die Baugenehmigung
schritt deshalb langsam voran.
|
| |
| Der Rhein hatte Ende des 19.Jahrhunderts noch alle Freiheiten ungestört zu fliessen.
Auf deutscher Seite gab es keine Bebauung, sondern nur Weinberge und Landwirtschaft.
Nur auf schweizer Seite wohnten Menschen am Rheinufer.
|
| |
| Das erste Konzept zur Ausnutzung des Rheins für Energiezwecke wurde durch Georg von
Struve 1871 ausgearbeitet. Er wollte allerdings kein Kraftwerk bauen, sondern über
Laufräder und Riemen andere Maschinen direkt antreiben. Seine Idee war nicht modern
genug, denn schliesslich kam die Elektrizität auf und ausserdem beschwerten sich
schweizer Hotelbesitzer wegen eventueller Beeinträchtigung des Kurbetriebes.
|
| |
| 1887 beauftragten die Firmen "Escher Wyss" aus Zürich, "Maschinenfabrik Oerlikon"
und "Zschokke & Co." aus Zürich den Bau eines Wasserkraftwerkes. Dieses Projekt
stiess aus technischen
Gründen auf Ablehnung. Deshalb wurde 1889 eine "Vorbereitungsgesellschaft" gegründet.
Diese sollte die Kraftwerkspläne verwirklichen. Am 20.Dezember 1890 erfolgte dann die
erste Genehmigung. Nach dieser Erteilung trat Emil Rathenau der
"Vorbereitungsgesellschaft" bei.
|
| |
Die Aushubarbeiten für das Kraftwerk wurden nur durch pure Menschenkraft begonnen.
Es sollte ein Grenzkraftwerk werden - Schweiz und Deutschland - und das grösste
Wasserkraftwerk in Europa.
Das Kraftwerk gilt als die Wiege der Stadt Rheinfelden.
Während der Bauarbeiten gab es massig Probleme. Über die 4 Jahre Bauzeit von "Klein
Amerika" (Volksmund) gab es viele Unfälle, Hochwasser und Einstürze von Baubaracken,
aber auch Eis im Winter.
Hauptabnehmer waren 3 chem. Unternehmen auf schweizer Seite. Private Haushalte
verhielten sich skeptisch gegenüber dem elektrischen Strom. Aber 1910 waren bereits
83 deutsche und elsässer Gemeinden und 47 schweizerische angeschlossen.
Die zunehmende Industrialisierung und Ansiedlung machte den Bau eines zweiten
Kraftwerkes erforderlich. Das Kraftwerk Wyhlen wurde 1910 fertiggestellt.
|
| |
Nach dem Weltkrieg I wurden die "Kraftübertragungswerke Rheinfelden" fast in den
Konkurs getrieben.
Die Hauptursache war die Hyperinflation in Deutschland. 60 % der Ausgaben mussten in Schweizer
Franken
geleistet werden. Am 28. April 1920 wurden deshalb zwei Notverordnungen verabschiedet. Diese
erlaubten es dem KW die Preise entsprechend der Inflation anzupassen. Die Strompreise für die
industriellen Stromabnehmer stiegen darufhin um das 3.700 fache, für Haushaltsstrom musste das
2.500 fache bezahlt werden. Aber die Preise stiegen noch weiter. Die bisherige monatliche
Abrechnung musste auf wöchentliche umgestellt werden, da die monatliche Abrechnung durch die
galoppierende Inflation zu viel Verlust verursacht hätte.
Aber auch dies war noch nicht genug - Strombezug musste sofort nach Abnahme bezahlt werden.
Die Bilanz 1923 schloss mit einer unglaublichen Summe:
|
| 712.706.777.595.735.957.000 RM |
| |
| Am 12. Oktober 1923 wurde die Rentenmark eingeführt, die am 30. August 1924 durch die neue
Reichsmark abgelöst wurde.
|
| |
Im Weltkrieg I wurde die Kraftwerksbrücke durch schweizer Grenzsoldaten gesichert.
Das Stromkabel II in die Schweiz wurde abgetrennt und so verlegt, dass es später wieder
leicht anschliessbar war.
Die Leitung in den Elsaß wurde am 9. August 1914 zerstört. Die Reparatur zog sich bis
in den September hinein. Einige Stromabnehmer fielen aus, vorallem aus der schweizer
Chemieindustrie. Insgesamt fiel die Stromproduktion um 82 % zurück.
Die beginnende grosse Kriegsproduktion sorgte aber für eine rasche Erholung.
Um 2.00 Uhr früh am 15. Oktober 1916 fand ein Sabotageanschlag auf das Kraftwerk statt.
Auf der schweizer Seite wurden 44 Bomben in ein Schlauchboot geladen. Grosse Bomben
sollen zuerst die Rechenanlagen zerstören, damit die kleinen Bomben in die
Turbinenanlagen
gespült werden und das Kraftwerk von Innen zerstören.
Das Unternehmen ging schief. Einige Bomben explodieren zu früh. Die Saboteure brachen
den Anschlag ab und liessen 22 Bomben zurück.
Im Januar 1917 gab es den ersten Fahndungserfolg. Karl Schenk, ein Angestellter des
Politischen Departments in Bern, wurde verhaftet.
Nach dem Weltkrieg II wurden an den Kraftwerksanlagen umfangreiche Reparaturen
durchgeführt. Die Ortsnetze im Markgräflerland wurden von 110 KV auf 220/380 KV
umgestellt.
Bis 1960 wurden über 100 Trafostationen errichtet. Bis 1964 wurde auch die
Stromversorgung
im Hotzenwald verbessert, welcher wirtschafliches Notstandsgebiet war.
|
| |
1959 begann der Eintritt des Unternehmens in das Atomzeitalter durch einen Beteiligung an der
"Kernreaktor-Finanzierungs-Gesellschaft" in Frankfurt und 1960 an der "Kernkraft Baden-Württemberg
Planungsgesellschaft" in Stuttgart.
Dadurch wurden die "Kraftübertragungswerke Rheinfelden" Mitinhaber des Kernkraftwerkes
Obrigheim mit 3 %.
Die "Kraftübertragungswerke Rheinfelden" hatten inzwischen Beteiligungen am Kraftwerk
Ryborg-Schwörstadt (13 %), Kraftwerk Schluchsee
(7,5 %), Rheinkraftwerk Säckingen (12,5 %) und Kraftwerk
Oberes Wiesental (24 %).
Die Potsdamer Konferenz am 2. August 1945 beschloss die völlige Zerschlagung Deutschlands als
Industriestaat. Nur noch Landwirtschaft und Fertigung für den eigenen Bedarf wurden Deutschland
erlaubt. Die französische Regierung übernahm die Kontrolle über Baden. Wichtige Produkte wie
Stahl, Leder
oder Holz durften nur noch nach Frankreich geliefert werden. Die Franzosen betrachteten Baden
als eine französische Kolonie und handelten auch danach.
Stromabschaltungen häuften sich. Die Betriebe wurden deshalb in 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe
erhielt in der 3. Woche keinen Strom. Der Bevölkerung wurde verboten - mitten im Winter -
ab dem 13.12.1945 Strom für Warmwasser oder Heizzwecke zu benutzen.
Erst am 25.2.1952 wurden die Strombeschränkungen aufgehoben.
|