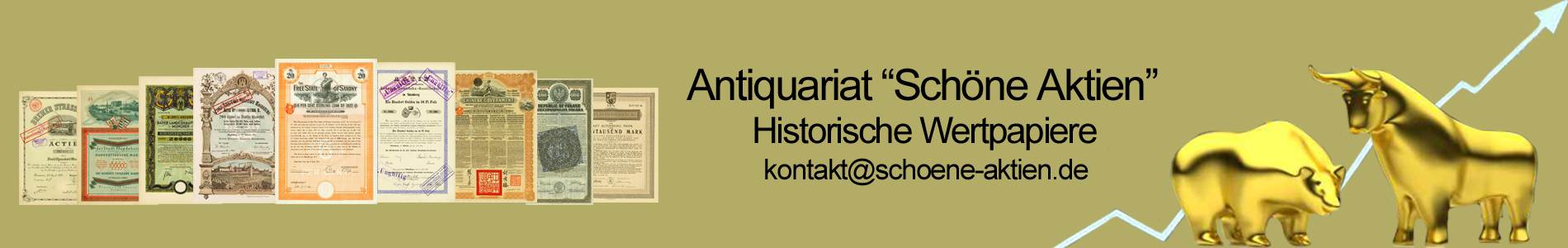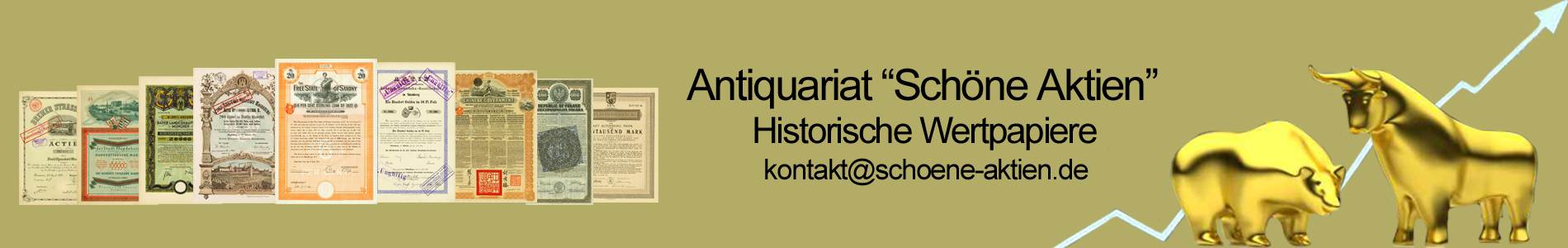| |
Die Badenwerk AG (EnBW)
|
gegründet in der grossen deutschen Inflation
|

Bestell-Nr.: DM21
 Preisliste
Preisliste

Bestell-Nr.: DM22b
 Preisliste
Preisliste

Bestell-Nr.: DM22
 Preisliste
Preisliste |
Das Badenwerk wurde 1921 als Badische
Landeselektrizitätsversorgung AG gegründet.
Heute besteht es aus
den Teilen:
- EnBW Kraftwerke AG
- EnBW Kernkraft GmbH
- EnBW
Trading GmbH
- EnBW Transportnetze AG
- EnBW Regional AG
- EnBW
Vertiebs- und Servicegesellschaft mbH
- Yello Strom GmbH
-
Gasversorgung Süddeutschland GmbH
- EnBW Gas GmbH
- EnBW Energy
Solutions GmbH
- EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH
- U-plus
Umweltservice AG |
| | In einem der schönsten Täler des
Nördlichen Schwarzwaldes liegt Forbach. Hier wurde das erste KW des
Badenwerkes gebaut (Rudolf-Fetteis-Werk). Die alte Forbacher Brücke wurde
vor über 400 Jahren gebaut, vom Hochwasser zerstört und vor 200
Jahren wieder aufgebaut. Sie ist mit 38 m die grösste Holzbrücke
dieser Art in Europa und steht in dieser Form seit 1778.
In Forbach stehen
ca. 14 Mill. m3 Wasser zur Stromgewinnung bereit. | | | Die Schwarzenbach-Talsperre
liegt auf einer Höhe von 668 Metern zwischen der
Schwarzwaldhochstraße und dem Murgtal. Der Stauseee ist mit zwei
Kilometern Länge der größte See im Nord- und Mittelschwarzwald.
Das Wasser wird in unter- und oberirdischen Druckrohren zur Stromgewinnung in
das Elektrizitätswerk nach Forbach (Rudolf-Fettweis-Werk/EnBW) geleitet.
Erbaut wurde die Talsperre von 1922 bis 1926. Mitunter arbeiteten bis zu 2 000
Menschen, darunter viele Handwerker aus Italien, an dem Bauwerk. Die
Granitsteine wurden aus umliegenden Steinbrüchen gebrochen. Da es anfangs
an Dynamit mangelte, wurde mit flüssiger Luft gesprengt. Die
Schwergewichtsmauer mit einem Volumen von 285 000 Kubikmetern gilt bis heute
als Pionierleistung im deutschen Staumauerbau. Durch seine idyllische Lage,
umrahmt von Schwarzwaldbergen, ist der See im Sommer wie im Winter ein
beliebtes Ausflugsziel. Von Mai bis September kann man rudern oder Tretboot
fahren. Einen herrlichen Blick über den See genießt man von der
Hotel- und Restaurant-Terrasse. Auf mehreren Schautafeln entlang des Uferweges
werden technische Daten sowie die Baugeschichte dargestellt. Circa drei
Kilometer oberhalb der Talsperre liegt einer der schönsten eiszeitlichen
Karseen, der Herrenwieser See.
1935 wurde der Stausee erstmals entleert, um
die Staumauer zu warten. Nach Ausbruch des 2. Weltkriegs wurde die
Schwarzenbachtalsperre zum Ziel amerikanischer und englischer Bombenangriffe;
am 19. Juli 1944 wurde die Staumauer bei einer Bombardierung leicht
beschädigt. 1952 wurden nach einer erneuten Entleerung des Sees
umfangreiche Sanierungen vorgenommen. Von 1988 bis 1992 wurde der Kontrollgang
im Innern der Staumauer verlängert, um den Sohlenwasserdruck besser
kontrollieren zu können. | | | Funktion der
Talsperre
Herrscht ein Überschuss in der
Elektrizitätserzeugung (hauptsächlich in der Nacht), wird das Wasser
von der Murgtalsperre in Kirschbaumwasen, über das Krafthaus in Forbach,
in den Stausee gepumpt. Bei Energiemangel (während des Tages) wird das
Wasser aus dem Stausee zur Stromgewinnung über die Wasserturbinen des
Rudolf-Fettweis-Werks zurück in das Ausgleichsbecken in Forbach geleitet.
Über einen Druckstollen von 1,7 km Länge wird das Wasser von der
Staumauer zu einem Wasserschloss geführt. Der Weg des Wassers setzt sich
anschließend oberirdisch in einer ca. 900 Meter langen Druckleitung fort
und endet an den Turbinen des Kraftwerks Forbach.
Technische Daten des
Wasserkraftwerkes
Die Gewichtsstaumauer ist 400 Meter lang und 65 Meter
hoch. Der See ist über 2 km lang. Der Auslegungs-Staupegel liegt auf 668,5
Meter ü. NN, dabei speichert der See 14,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Am
Grund der Staumauer gibt es einen Grundablass zur Entleerung des Stausees, die
2 Monate und 14 Tage dauert. 24 Öffnungen unterhalb der Dammkrone stellen
sicher, dass bei Hochwasser die Mauer nicht überlastet wird. Auf der
Seeseite dient ein Wasserentnahmeturm der Wasserentnahme für den
Druckstollen. Betreiber ist die EnBW Kraftwerke AG. Das gesamte Stauseesystem
wurde nach dem früheren Vorstand der Badenwerk AG, Rudolf Fettweis, der am
Bau der Anlagen beteiligt war, Rudolf-Fettweis-Werk genannt. Standort ist
Forbach. | | | Etwas zur Geschichte der
Forbacher Brücke.
Bevor die jetzige Brücke gebaut wurde, gab es
bereits eine Reihe von Brücken über die Murg. Aber die meisten von
ihnen wurden durch das Murghochwasser wieder weggerissen. Die heutige
Brückenform stammte vom Karlsruhe Ingenieur Otto Lindemann. Zum Bau der
Brücke wurden insgesamt 150 (!) uralte Eichen gefällt, die 2.700 m
Eichenbalken für die freitragende Konstruktion gaben (40 m Länge).
Die Brücke ist mit Schindeln gedeckt. Zur Finanzierung des
Brückenbaues erhoben die Gemeinden Forbach, Bermersbach und Gausbach einen
Brückenzoll. Die Brücke wurde von Fußgängern, Holz- und
Weinfuhrwerken, 1796 von französischen Truppen und 1814 von russischen
Kosaken überquert. Dies hielt die Brücke alles aus. Als aber Panzer
und Geschütze im Weltkrieg II darüber rollten, war es aus - die
Brücke senkte sich um 50 cm.
Am 22. Juli 1954 musste sie gesperrt
werden. Sie sollte daraufhin abgerissen und durch eine Betonkonstruktion
ersetzt werden. Aber engagierte Bürger verhinderten dies. Für 300.000
DM wurde 1954 die Holzbrücke neu gebaut. Im Stirnbalken steht der Spruch:
"1954 - Durch Zeit und Krieg war ich beinahe verloren, durch Bürgersinn,
Staat und Spenden ward ich wieder neu geboren - 1955". | | | Die Aktien
und die Geschichte
Die Landkarte der Stromwirtschaft glich bis zur
Liberalisierung einem Fleckenteppich. Die Gebiete der Stromunternehmen sahen
aus wie kleine Herzogtümer. Hier hatten sie das Sagen - als eines der
letzten Monopole. Diese fielen erst mit dem Energiewirtschaftsgesetz.
Theoretisch blieben zwar die Kunden dem bisherigen Stromlieferanten verbunden,
aber der Strom selbst konnte von wo anders her kommen. So könnte ein
Hamburger nun auch Strom vom Badenwerk beziehen. Das Gesetz schreibt Trennung
zwischen Stromerzeugung, Netzbetrieb und Verkauf vor. Die alten EVU`s bilden
heute meist nur eine Holding.
Grossherzog Friedrich von Baden
überliess der Privatwirtschaft und den Kommunen die Stromerzeugung. 1890
gab es in Baden 155 E-Werke in 61 Gemeinden; davon hatte Mannheim allein 34
Stück. Dies waren alles Blockstationen, die Gleichstrom in die
nächste Umgebung lieferten (300-500 m).Erst das 1898 am Hochrhein gebaute
KW Rheinfelden lieferte 10 000 KW und war damit das grösste
Wasserkraftwerk Europas. Die Finanzierung erfolgte durch Grossbanken, die der
AEG nahe standen. Hauptkunde war die AEG-Tochter Elektrochemische Werke
Bitterfeld und die Schweizerische Aluminiumindustrie AG, die neben dem
Kraftwerk grosse Betriebe errichtete. Auch "Persil" wurde in Rheinfelden
produziert. Die Konzession für Rheinfelden wurde unbefristet erteilt und
das weckte den Hunger auf noch mehr KW. So wurde 1904 das KW Laufenburg gebaut.
Aber dann kam der Umweltschutz auf, weil diesem KW die dortigen
Rheinstromschnellen zum Opfer fielen. Diesem Schutz des Hochrheins trug dann
auch die Regierung in Karlsruhe Rechnung (zwischen 1906-1908). Die
Unterstützung ging weg von der Grossindustrie hin zum Gemeinwohl.
Erster Schritt hin zur eigenen Landesstromversorgung war das Murgwerk in
Forbach, das 1919 fertig wurde. 1921 wurde die Gründung der "Badischen
Landeselektrizitätsversorgung AG" beschlossen. Bis 1937 waren alle
Landesteile mit Strom versorgt. Nach dem Weltkrieg II waren das 744
Gemeinden.
Anders war das in Württemberg. Hier gab es kein dem
Badenwerk vergleichbares Verbunduntenehmen. Es gab vielmehr kleine Unternehmen,
die den Gemeinden gehörten. Der württembergische Staat hatte keine
nennenwerte eigene E-Wirtschaft, er förderte stattdessen die dezentrale
Stromwirtschaft. Erst 1938 wurde das zentrale Unternehmen
Energie-Versorung-Schwaben (EVS) gegründet, deren Gesellschafter aber auch
wieder die Kommunen waren. | | | | 1926 wurde das Leitungsnetz
fertiggestellt, das die Wasserkraftwerke am Hochrhein und im Schwarzwald mit
den Kohlekraftwerken in Mannheim verband. In Mannheim erfolgte der Anschluss an
die von
RWE nach
Süddeutschland verlegte Stromleitung. Dieser Anschluss an das
süddeutsche Stromnetz war für die RWE sehr wichtig. Kurz vor seinem
Tode liess der RWE-Gründer Hugo Stinnes 1924 eine 220 KV-Leitung nach
Süddeutschland projektieren. Er hatte Angst die RWE-KW würden bald
ohne Braunkohle dastehen. (Siehe auch die Beschreibung in
Walchensee-KW).
| | | Das Badenwerk feierte 1996
(wie auch das Bayernwerk) das
75jährige Jubiläum. Beide hatten das Ziel, ihrem Land eine sichere
und preisgünstige Stromversorgung zu geben. Aber beide hatten einen
grossen Nachteil: sie hatten keine Kohle, also mussten sie auf Wasserkraft und
Kernenergie zurückgreifen.
Im Norden von Baden (Mannheim) gab es
allerdings Kohlekraftwerke. Die Kohle wurde auf dem Rhein herangeschaft.
1912 wurde ein Gesetz zum Bau des Murgkraftwerkes in Forbach beschlossen. Der
hohe Bedarf erforderte gleich eine Erweiterung - das Schwarzenbachwerk als
zweite Staustufe. Dieses Murgwerk in Forbach bildete 1921 das Herzstück
und das grundkapital des "Badenwerkes". In diese Badenwerk-Gesellschaft brachte
das Land alle staatlichen Anlagen zur Stromgewinnung ein und verpflichtete
sich, das gesamte Grundkapital stets im Staatsbesitz zu belassen. Erst 1970 hob
der Landtag diese Vorschrift auf. | | | Der Karlsruher
Rheinhafen wurde am 1.mai 1901 eröffnet. Im Jahre 2001 feierte er deshalb
sein 100jähriges Bestehen. Heute gehört ere zu den grössten
deutschen Binnenhäfen. Die offizielle Eröffnung wurde auf das Jahr
1902 verschoben, auf das 50jährige Regierungsjubiläum des allseits
beliebten Grossherzogs Friedrich I.
Auch das städtische
Elektrizitätswerk von Karlsruhe wurde am neuen Rheinhafen im gleichen
Zeitraum gebaut. Neben Strom liefert es auch heute noch zusammen mit dem
Rheinhafendampfkraftwerk des Badenwerkes Heisswasser für das
Fernwärmenetz von Karlsruhe.
Im Gegensatz zu heute, waren die
Versorgungsbegiete der Stromlieferanten noch nicht abgesteckt. Jeder
Stromversorger musste also befürchten, dass die Konkurrenz in der
Nachbarschaft einsteigen wollte. Deshalb wurde behindert wo es nur ging. So
verhinderte der preussische Staat jahrelang das Vordringen der RWE. Ein
Streitpunkt war die Stromversorgung der Stadt Frankfurt a. M. Erst 1927 kam es
zum sogenannten "Elektrofrieden" und darauffolgend zur Gründung der
PreussenElektra. Doch es dauerte noch lange, bis die Claims entgültig
abgesteckt waren, die KW also Monopole wurden. Die RWE trieb aus Angst vor dem
Ende der Braunkohle ihre Verbundschiene nach Süddeutschland voran und
gewann die VEW und das Badenwerk als Partner. Der "Rest" - also Bayernwerk, die
EWAG (reichseigenen Elektrowerke) und die preussischen Elektrizitätswerke
AG weiteten sich nach Osten aus um die Wasserkräfte der Alpen mit den
ostdeutschen Braunkohlegruben zu verbinden. Im Mai 1928 wurde die "Berliner" AG
für deutsche Elektrizitätswirtschaft als Gegengewicht zur RWE
gegründet. Die RWE gründete daraufhin im Februar 1929 mit allen
Stromlieferanten zwischen der niederländischen und schweizer Grenze (also
auch dem Badenwerk) die Frankfurter "Westdeutsche Elektrizitäts AG".
Zum letztemn Gefecht kam es aber nicht, da die Westgruppe im Mai 1929 der
Berliner AG beitrat. Die neue Gesellschaft hiess "AG für deutsche
Elektrizitätswirtschaft" und ist die Vorläuferin der heutigen
Deutschen Verbundgesellschaft. |
Wem gehört die EnBW?
(Stand 2006)
- 45,01% EDF International (franz. staatl.
Stromgesellschaft)
- 2,3% EnBW Energie Baden-Württemberg AG
-
45,01% Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke
- 0,58%
Landeselektrizitätsverbund Württemberg
- 1,79% Streubesitz
-
2,59% Badische Energieaktionärs-Vereinigung
- 1,29%
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau
- 0,46%
Neckarelektrizitäts-Verband |
| Die
EnBW-Aktie |
| |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| Anzahl Aktien |
221.011 |
220.711 |
231.974 |
243.957 |
244.257 |
| Jahresschlußkurs (€) |
33,94 |
25,15 |
29,10 |
45,80 |
50,55 |
| Dividende (€)
|
0,66 |
- |
0,70 |
0,88 |
1,14 |
| Mitarbeiter |
| |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| Strom |
12.674 |
12.004 |
11.030 |
11.754 |
| Gas |
314 |
639 |
883 |
1.105 |
| Energie- und
Umweltdienste |
4.865 |
4.450 |
5.364 |
7.742 |
|
Der letzte
Schritt: Fusion Badenwerk mit EVS
1995 gründeten die Eigner von
EVS und Badenwerk eine sogenannte Stimmrechtsbindungsgesellschaft
(Energieverbund Baden-Würtemberg, EBW) um beide Kraftwerke zu
verschmelzen. Das Stammkapital war 500.000,- DM und bis zum 29.9.1995
aufzubringen. Der Zusammenschluss war bis Ende 1998 geplant, erfolgte aber
bereits zum 1.1.1997.
Die EnBW wurde als Holding konzipiert, zuständig
für die strategische Planung und Führung. Die Tochtergesellschaften
erledigten den operativen Teil.
Die Fusion erfolgte durch Aktientausch.
Das Umtauschverhältnis wurde durch die Frankfurter Gesellschaft Coopers
und Lybrand festgelegt. Ergebnis: 1:1,58 zu Gunsten des Badenwerkes.
Auch
in der Schweiz wird versucht Fuss zu fassen. Das Bayernwerk, EnBW und die
Nordschweizer Kraftwerke (NOK) in Baden/Schweiz kauften die Firma Watt AG, eine
Tochter der Elektrowatt AG, die zur Credit Suisse Group gehört. Die Credit
Suisse hält 44,9% der Elektrowatt AG. Den übrigen Aktionären
(55,1%) wurde ein Übernahmeangebot übergeben. Danach gibt Credit
Suisse 38,5% aller Elektrowatt Aktien an die vorgenannten Kraftwerke und 41,5%
an die
Siemens AG und
behält 20%. Danach wird die Elektrowatt AG aufgespalten; die Energieseite
geht an die WATT AG, die Industriebeteiligungen verbleiben bei Elektrowatt. Am
Schluss erhält Siemens alle Elektrowatt Anteile, während die Credit
Suisse alle Watt Aktien erhält.
So einfach kann das gehen. |
Das Deutsche
Reich und die Stromwirtschaft
Die einzelnen deutschen Länder
wollten mit der Elektrizitätswirtschaft vorallem die eigenen Länder
entwickeln und das Allgemeinwohl stärken. Die Reichsregierung wollte aber
vorallem Geld verdienen. Die Elektrizitätspolitik bestimmte deshalb auch
das Reichsschatzministerium. Schon 1908 wollte das Ministerium eine Stromsteuer
einführen, musste sich aber mit einer kümmerlichen
"Leuchtmittelsteuer" zufrieden geben.
Ausserdem sollte ein
"Starkstrom-Monopol" eingerichtet werden. Die Länder legten ihr Veto
ein.
Der Weltkrieg I veränderte vieles; die allmächtige
Kriegsrohstoff-Abteilung unter Walther Rathenau mischte sich auch in die
Stromwirtschaft ein. Die Personalliste dieser Abteilung war das reinste
AEG-Adressbuch.
Das Reichs-Elektromonopol wurde unter dem Begriff
"Gemeinwohl" eingeführt und durch die Rathenau-Abteilung verwaltet. Um die
nackte Existenz der Bevölkerung zu sichern verabschiedete die Weimarer
Nationalversammlung im März 1919 ein Rahmengesetz zur Sozialisierung der
Wirtschaft. Das Gesetz stärkte vorallem die Position der deutschen
Länder, denn die bemühten sich schnell durch Gründung eigener
Landesgesellschaften zur Stromversorgung vollendete Tatsachen zu schaffen, an
denen eine wie immer geartete Reichsregierung nicht mehr vorbeikam. Die
Pläne für eine zentrale Stromwirtschaft scheiterten also schon in den
1920ern.
Allerdings war das Reich auch erfolgreich tätig. Die Chance
für einen Erfolg kam am Ende des Weltkrieges I, als die AEG einen
Käufer für seine Elektrowerke AG (EWAG) suchte. Das Grosskraftwerk
Zschornewitz war kurz vor dem Zusammenbruch, weil es feste Strompreise mit den
Grossabnehmern vereinbart hatte, die aber nicht halten konnte. Die
Rüstungsindustrie brauchte aber diesen Stromerzeuger. Deshalb kaufte das
Reich im Sommer 1917 die EWAG für 50 Mill Mark von der AEG. Diese
reichseigenen Kraftwerke entwickelten sich sehr gut. Im Frühjahr 1923
wurde die EWAG mit anderen Reichsbeteiligungen in die neue gegründete
Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG (VIAG) eingebracht. |
| | Um Strom zu benutzen,
muß es vom Kraftwerk zum Kunden geliefert werden. Dieses Stromnetz ist
komplex und unglaublich groß.
Hier finden Sie
einige Informationen darüber.
Die Stromkonzerne fahren kräftige
Gewinn ein. Jahrelang hatten die Energieerzeuger Wettbewerbshüter,
Politiker und Bürger an der Nase herumgeführt. Wettbewerb herrschte
kaum, denn die Absatzgebiete ihrer Waren (Strom) waren wie amerikanische
Goldgräberclaims abgesteckt. Der fehlende Wettbewerb führte zu
überhöhten Preisen. Gleichzeitig wurden wichtige Investitionen in
Kohlendioxid-arme Kraftwerke verschoben - denn das brachte ja weniger Dividende
für die Aktionäre. Lange schaute die Politik diesem Treiben tatenlos
zu - erst 2007 machte sich Verbraucherprotest bemerkbar. Neue und
schärfere Gesetze wurden erlassen und zum Wechsel des Stromlieferanten
aufgerufen.
Nach einer Durchsuchung der Geschäftsräume von E.on
und der Zwischenlagerung dieser Aktien in einem E.on-Gebäude wurde der
versiegelte Raum aufgebrochen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, daß
dadurch eventuell wichtige Aktien manipuliert sein könnten. E.on sieht
sich einer Strafe von 250 Millionen EUR ausgesetzt.
Aber nicht nur die
überhöhten Strompreise, auch die sonstigen Energiepreise wie z.B. bei
Gas führen zu vermehrten Eingriffen der Politik. Bei den Gaspreisen soll
es in den vergangenen Jahren zu Absprachen über Märkte, Mengen und
Preise gekommen sein.
Auch die Durchleitung des Stromes durch die
Stromkabel soll zu überhöhten Preisen geführt haben. Hier will
die Bundesnetzagentur kräfig kürzen. Um Strafzahlungen zu umgehen,
gab es im März 2006 einen Kuhhandel mit der EU-Kommission. Einer der
großen deutschen Stromerzeuger verkauft das firmeneigene Stromkabelnetz
und geht damit straffrei aus. Da aber besonders das Stromkabelnetz ein
wichtiger Punkt im deutschen Energiemarkt ist, gab es hierüber einen
heftigen Disput mit der Bundesregierung. | | | Nach Expertenmeinung gibt es
demnächst eine Stromlücke. Die Kraftwerke in Deutschland können
den benötigten Strom nicht mehr liefern, da alternative Energien noch
nicht ausreichend vorhanden sind und die Kernkraftwerke abgeschaltet werden.
Also werden neue Kohlekraftwerke geplant.
Das Stromnetz ist komplizierter
als gedacht. Schon kleine Ausfälle können zu großen
Störungen der Versorgung führen. Außerdem sorgen die momentanen
Besitzverhältnisse der Stromnetze zu überhöhten
Kundenpreisen.
Mehr Infos finden Sie
hier |
|