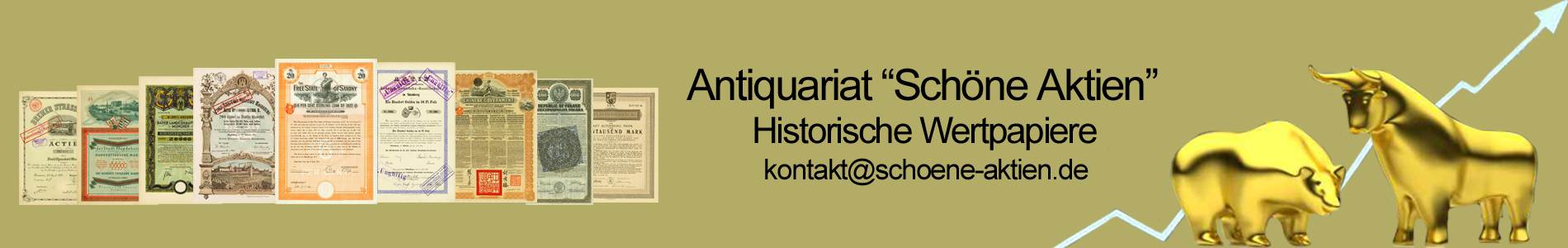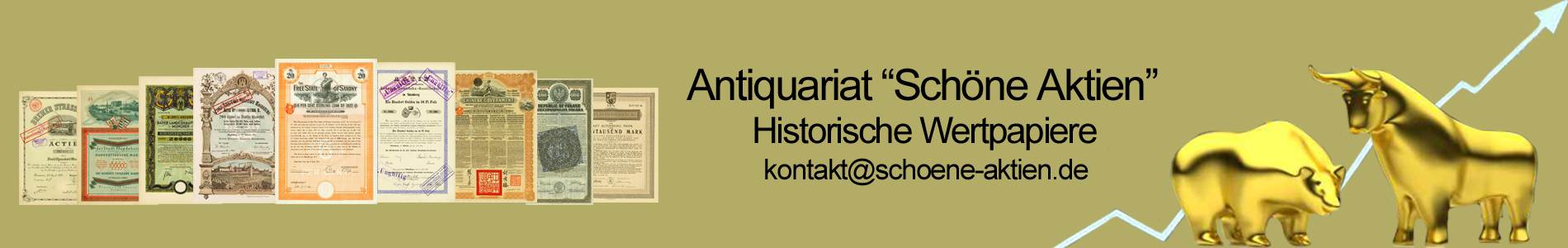| |
Die Baraber vom Walchensee
|
Eine schöne deutsche alte historische Aktie
|
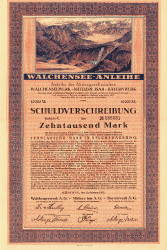
Bestell-Nr.: D14
 Preisliste
Preisliste |
In Berchtesgaten
wurde bereits 1889 mit einem kleinen Kraftwerk von 60 PS die erste
öffentliche Stromversorgung installiert. Wenig später wurde die Stadt
Fürstenfeldbruck elektrisch versorgt.Es musste nicht immer Kohle sein,
Wasserkraft tat es auch.
So setzte sich der Gründer des Deutschen
Museums, Oskar von Miller, um 1900 für die Ausnutzung des 200 m
Höhenunterschiedes zwischen Walchensee und Kochelsee ein. Mit dem so
gewonnenen Strom sollten die bayrischen Bahnen und eventl. ganz Bayern versorgt
werden. Von Miller nannte das von ihm so stark geforderte Kraftwerk bereits
"Bayernwerk". |
| Die Inflation
war schon dramatisch, als 1921 die erste Anleihe für das Bayernwerk
aufgelegt wurde. Einige Zeit später waren auch die 300 Millionen Mark
nichts mehr wert. Trotz dieses Geldverfalls wurde 1924 mit dem Bau des
Walchenseekraftwerkes begonnen. |
|
Die Aktie und die Geschichte |
1908 hatte die
bayrische Regierung einen internationalen Wettbewerb für die Gestaltung
des Walchenseekraftwerkes ausgeschrieben. 31 Entwürfe wurden
eingereicht.
1910 genehmigte der Landtag eine erste Rate für den Bau
eines Walchensee-Kraftwerkes und am 1. Juni 1911 ging es los. Bauleiter wurde
Regierungsrat Theodor Freytag, der bereits Erfahrung für Bauen im Gebirge
hatte (er baute z.B. die Kesselbergstrasse). |
Der Weltkrieg I
verzögerte das Bauen, doch am 18.6.1918 stimmte der bayrische Landtag dem
Kraftwerksbau erneut zu. Unmittelbar nach Kriegsende 1918 wurde mit den
Arbeiten für die Werkstrasse und die Baustelle in Altjoch begonnen. Die
bayrische Revolutionsregierung ernannte von Miller zum Staatskommissar für
die beiden Projekte "Walchenseewerk" und "Bayernwerk".
2 Jahre später
wurden die beiden AG`s gegründet. Durch die enorme Inflation, politische
Wirren und grosse Armut - die zu mehreren Streiks führte - ging der Bau
nur langsam voran.
Oscar von Miller war aber mit der Entwicklung des
"Bayernwerkes" so unzufrieden, daß er kurz nach der Gründung
ausstieg.
Fast zum gleichen Zeitpunkt wurde in München die
"Walchenseewerk AG" und die "Mittlere Isar AG" gegründet. Alle drei
Gesellschaften wurden 1923 zu einer vom bayerischen Statt beherrschten
Betriebsgesellschaft zusammengeschlossen. |
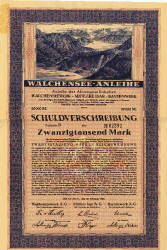
Bestell-Nr.: D155
 Preisliste
Preisliste |
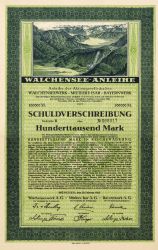
Bestell-Nr.: D17
 Preisliste
Preisliste |
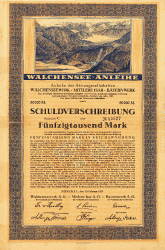
Bestell-Nr.: D16
 Preisliste
Preisliste |
|
Erhebliche Schwierigkeiten
bereitete die Finanzierung der Großkraftwerke "Walchenseewerk" und
"Mittlere Isar". Zur Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel wurde ein
Vertrag mit dem bayerischen Staat und der "AG Walchenseewerk und Mittlere Isar"
geschlossen. Der bayerische Staat übernahm die Bürgschaft für
die Verzinsung aller Schuldverschreibungen. Im April 1921 wurde ein gleicher
Vertrag mit dem "Bayernwerk" abgeschlossen. Damit wurde der Weg freigemacht
für die Herausgabe der wunderschönen Walchenseeanleihen.
Die
Inbetriebnahme des Wasserkraftwerkes "Walchenseewerk" war 1924. Damit
genügend Wasser da ist, wurden Isar und Rißbach durch unterirdische
Stollen zum Wasserschloss geleitet. Der obere Teil des Wasserschlosses umfasst
das Staubecken, der untere Teil die genieteten Fallrohre. Durch 6 Rohre
stürzt das Wasser 200 m tief in die Turbinenkammer am Kochelsee.
Die
schweren Teile für die Turbinensätze kamen per Bahn nach Kochel.
Über ein eigens verlegtes Gleis wurden die Teile an den See transportiert
und auf dem See mit einem Ponton. Bilder zeigen die schweißtreibende
Arbeit der Bauarbeiter, die meist aus dem Ausland kamen. Deren Aussehen brachte
sie zu dem Namen "Baraber vom Walchensee".
40 000 cm3 Fels und Schutt
mussten bewegt werden. Als das Kraftwerk fertig wurde, gab es keine Feier. Erst
1925 wurde diese nachgeholt. |
| Oskar von Miller war neben
Siemens der treibende Kopf der deutschen Stromversorgung. Von Miller hatte in
den 1880ern die E-Werke in Berlin gebaut. Neben dem Deutschen Museum in
München setzte er sich auch 1882 ein weiteres Denkmal durch die
Gleichstrom-Übertragung von Miesbach nach München. Von Miller war
auch 1891 der techn. Leiter bei der Einrichtung der ersten
Drehstrom-Übertragung über 175 km von Lauffen/Neckar nach Frankfurt
a.M. Diese wurde rechtzeitig zur Internationalen Elektrizitätsausstellung
fertig. Durch diese weite Übertragung wurde es möglich statt kleiner
dezentraler Kraftwerke Grosskraftwerke zu bauen. Eines davon waren die
Isarwerke/München, die er 1894 plante. Er legte den Grundstein zur
einheitlichen Stromversorgung der bayrischen Rheinpfalz; dies führte 1912
zur Gründung der Pfalzwerke. |
| Auf der
Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt 1891 wurde der
Expertenstreit um Gleichstrom und Wechselstrom entschieden. Die auf der
Ausstellung vorgeführte Drehstromübertragung von Lauffen nach
Frankfurt über 175 km bewies, dass Wechselstrom über grosse
Entfernungen übertragen werden konnte. 1892 erfolgte dann die erste
deutsche Überlandversorgung mit Drehstrom vom Elektrizitätswerk Argen
in Wangen/Allgäu. |
Doch dann kamen Probleme
auf. Das Walchensee-Kraftwerk war für die Stromversorgung der Bayr.
Staatsbahnen gedacht. Dies wurde aber 1912 fallen gelassen. Die Gründe:zu
hohe Kosten, militärische Bedenken, vermutete Überproduktion. Deshalb
schlug von Miller 1915 vor, das Kraftwerk an ein zukünftiges Bayernwerk
anzuschliessen. Der Weltkrieg I und seine Folgen, die Hyperinflation,
politische und wirtschaftliche Probleme verlangsamten aber alles. Aber als er
Staatskommissar wurde, gründete er 1921 das Walchensee- und die
Bayernwerke. Damit konnten die entlassenen Soldaten wieder Arbeitsplätze
finden. Im gleichen Jahr wie das Bayernwerk wurde auch das
Badenwerk
gegründet. Das 1921 errichtete Bayernwerk blieb aber hinter den
Plänen von Millers zurück, da die bereits vorhandenen
Stromproduzenten sich wehrten Teil der Bayernwerke zu werden. Auch die
Überlandwerke der Stromverteiler konnten nicht dem Bayernwerk zugeteilt
wrden. So kam der Strom für den grössten Teil Bayerns vom
Grosskraftwerk Franken, den Isar-Amperwerken, den Stadtwerken München, dem
Lech-Elektrizitätwerk und der Rhein-Main-Donau AG. Das neue Bayernwerk
konnte somit nur den Rest des Stromes liefern. Noch Mitte der 1930er kam der
Strom der Bayernwerke nur vom Walchensee-KW, vom KW an der mittleren Isar und
vom Braunkohle-KW Schwandorf.
Von Miller zog sich 1923 vollständig aus
der staatlichen Energiepolitik zurück, als Zweifel an seiner Kompetenz
aufkamen, insbesondere wegen der gescheiterten Fusion mit dem Grosskraftwerk
Franken.
Ab 1924 lieferte das Walchenseewerk Drehstrom an die als
Betriebsgesellschaft fungierende Bayernwerke AG und Wechselstrom an die
Deutsche Reichsbahn.
Parallel zum Walchensee-Grossprojekt band die staatl.
Bayernwerke AG mit dem 110 KV Verbundnetz die bestehenden Überlandwerke in
ein fast geschlossenes Landes-Stromnetz ein. Das Ziel war jedoch der deutsche
Großverbund aller deutschen Überlandwerke. Dies wurde in einem
ersten Schritt 1929 durch einen Vertrag mit den
RWE erreicht. |
Noch heute liefert die fast
unveränderte Anlage für Bayernwerk Wasserkraftwerk AG Strom für
das Netz und die Deutsche Bahn. Die Jahresleistung beträgt 300 Mill
KW-Stunden. Seit 1924 hat das Kraftwerk 20 724 Gigawatt-Stunden Strom geliefert
- mit dieser Energie könnte eine Großstadt wie München
über fast 3 Jahre versorgt werden.
Der bayrische Staat gab 1994 seine
mehrheitliche Beteiligung an den Bayernwerken ab und es wurde Teil der Viag.
Damit war dann das Bayernwerk neben RWE, PreussenElektra der drittgrösste
deutsche Stromerzeuger mit fast 1400 Mitarbeitern. Die Bayernwerk AG als
Tochter der bayrischen Viag fusionierte 2000 mit der VEBA zu E.on |
Für das
Walchensee-Kraftwerk ist der 15.Juni eines jeden Tages besonders wichtig. Dann
wird auf den Wasserstand-Pegel geschaut. Ist der tiefste See Deutschlands
(801,49 m) nicht randvoll gefüllt, muss für jeden fehlenden
Zentimeter bezahlt werden - das kann bis zu 60 000 EUR im Jahr betragen.
In
der Zeit vom 15. Juni bis 15.September darf die Seehöhe 30 cm über
oder 50 cm unter dem Normalpegel liegen. In der übrigen Zeit kostet es
Geld an die 50 Seeanlieger die 1957 diese Regelung erstritten haben. Das Geld
geht an eine Stiftung. Im Winter fließt weniger Wasser in den See,aber es
wird mehr Strom benötigt, also muß mehr Wasser aus dem See entnommen
werden. Deshalb darf im Winter der See bis 4.6 m absinken. In den
Nachkriegsjahren durfte der See gar um 6.60 m absinken. Aber am 15.Juni muss
alles wieder stimmen.
Seit 1957 hat das Bayernwerk ca. 250 000 EUR an die
Stiftung zahlen müssen.
Das Walchensee-Kraftwerk gehört zu E.on
und ist ein Spitzenlast-Kraftwerk. |
Eine bekannte Geschichte ist
der Konkurrenzkampf zwischen dem Bayernwerk (Südschiene) und dem RWE
(Nordschiene). Die RWE hatte Angst, die Braunkohlegruben würden bald
nichts mehr fördern können. Deshalb liess der 1924 verstorbene
RWE-Gründer Hugo Stinnes kurz vor seinem Tode eine 220 KV-Leitung nach
Süddeutschland planen. Sollte die Braunkohle ausgehen, dann könnte
RWE immer noch Strom von den süddeutschen Wasser-KW beziehen. Denn diese
hatten z.B. mit dem
Badenwerk gute
Wasserkraftwerke. Das Bayernwerk befürchtete die RWE-Konkurrenz, denn die
hatte schon Anteile an den Lech-KW und über den Lahmeyer-Konzern das Sagen
bei den Main-KW. Die Versorgungsgebiete der Stromlieferanten waren damals noch
nicht festgelegt (kein Monopol). Auch andere hatten Angst um ihre Kunden. So
weigerte sich die preussische Regierung der RWE die Stromversorgung für
Frankfurt a. Main zu gestatten. Erst 1927 kam es zum "Elektrofrieden". Aber der
entgültige Frieden kam erst 1950.
Der Elektrokrieg mit der RWE begann
schon 1920, als das RWE die Mehrheit an der Braunkohlengrube in Helmstedt
erwarb, die eigentlich Braunkohle für ein preussisches KW liefern sollte.
Preussen "schlug" zurück, in dem es 1925 mitten im RWE-Gebiet eine
Braunkohlengrube mit KW kaufte. Aber 1927 kam es zu einer Einigung; Preussen
und RWE tauschten jeweils ihre "Faustpfänder" im gegnerischen Gebiet und
beschlossen sich für 50 Jahre keine Konkurrenz zu machen. Der preussische
Staat gründete daraufhin die PreussenElektra, die sofort ihre Claims im
Osten absteckte. Die Bayernwerke, die Landesversorger von Sachsen,
Thüringen und Hamburg schlossen sich der PreussenElektra an.
Die
Stromnachfrage stieg in den 1960ern gewaltig an. Die Wasserkraftwerke der
Bayernwerke konnten den Bedarf nicht mehr decken und für Kohlekraftwerke
lag Bayern zu weit weg von den Kohlegruben. Deshalb wurde zusammen mit dem RWE
das Kernkraftwerk Grundremmingen in Betrieb gesetzt. 1976 stammte 1 % des
Bayernwerk-Stroms aus Kernenergie; heute sind es 55 %. Wasserkraft hat immer
noch einen Anteil von 20 %.
Der bayrische Saat gab 1994 alle seine Anteile
an den Bayernwerken ab. |
| | Um Strom zu benutzen,
muß es vom Kraftwerk zum Kunden geliefert werden. Dieses Stromnetz ist
komplex und unglaublich groß.
Hier finden Sie
einige Informationen darüber.
Die Stromkonzerne fahren kräftige
Gewinn ein. Jahrelang hatten die Energieerzeuger Wettbewerbshüter,
Politiker und Bürger an der Nase herumgeführt. Wettbewerb herrschte
kaum, denn die Absatzgebiete ihrer Waren (Strom) waren wie amerikanische
Goldgräberclaims abgesteckt. Der fehlende Wettbewerb führte zu
überhöhten Preisen. Gleichzeitig wurden wichtige Investitionen in
Kohlendioxid-arme Kraftwerke verschoben - denn das brachte ja weniger Dividende
für die Aktionäre. Lange schaute die Politik diesem Treiben tatenlos
zu - erst 2007 machte sich Verbraucherprotest bemerkbar. Neue und
schärfere Gesetze wurden erlassen und zum Wechsel des Stromlieferanten
aufgerufen.
Nach einer Durchsuchung der Geschäftsräume von E.on
und der Zwischenlagerung dieser Aktien in einem E.on-Gebäude wurde der
versiegelte Raum aufgebrochen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, daß
dadurch eventuell wichtige Aktien manipuliert sein könnten. E.on sieht
sich einer Strafe von 250 Millionen EUR ausgesetzt.
Aber nicht nur die
überhöhten Strompreise, auch die sonstigen Energiepreise wie z.B. bei
Gas führen zu vermehrten Eingriffen der Politik. Bei den Gaspreisen soll
es in den vergangenen Jahren zu Absprachen über Märkte, Mengen und
Preise gekommen sein.
Auch die Durchleitung des Stromes durch die
Stromkabel soll zu überhöhten Preisen geführt haben. Hier will
die Bundesnetzagentur kräfig kürzen. Um Strafzahlungen zu umgehen,
gab es im März 2006 einen Kuhhandel mit der EU-Kommission. Einer der
großen deutschen Stromerzeuger verkauft das firmeneigene Stromkabelnetz
und geht damit straffrei aus. Da aber besonders das Stromkabelnetz ein
wichtiger Punkt im deutschen Energiemarkt ist, gab es hierüber einen
heftigen Disput mit der Bundesregierung. | | | Nach Expertenmeinung gibt es
demnächst eine Stromlücke. Die Kraftwerke in Deutschland können
den benötigten Strom nicht mehr liefern, da alternative Energien noch
nicht ausreichend vorhanden sind und die Kernkraftwerke abgeschaltet werden.
Also werden neue Kohlekraftwerke geplant.
Das Stromnetz ist komplizierter
als gedacht. Schon kleine Ausfälle können zu großen
Störungen der Versorgung führen. Außerdem sorgen die momentanen
Besitzverhältnisse der Stromnetze zu überhöhten
Kundenpreisen.
Mehr Infos finden Sie
hier |
|