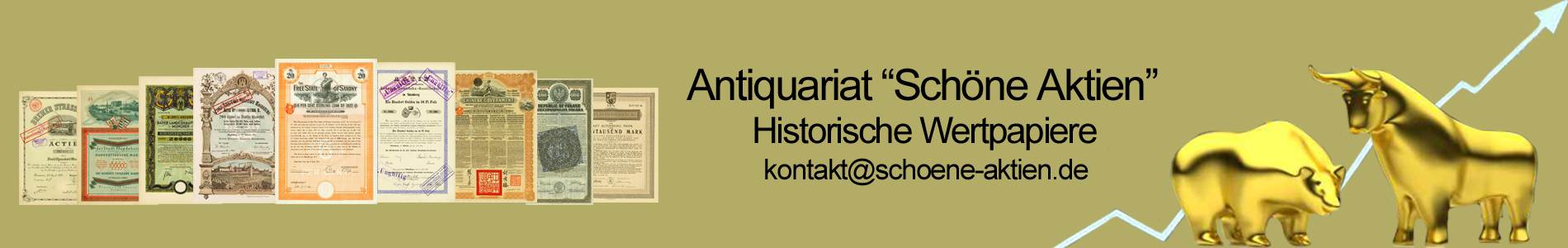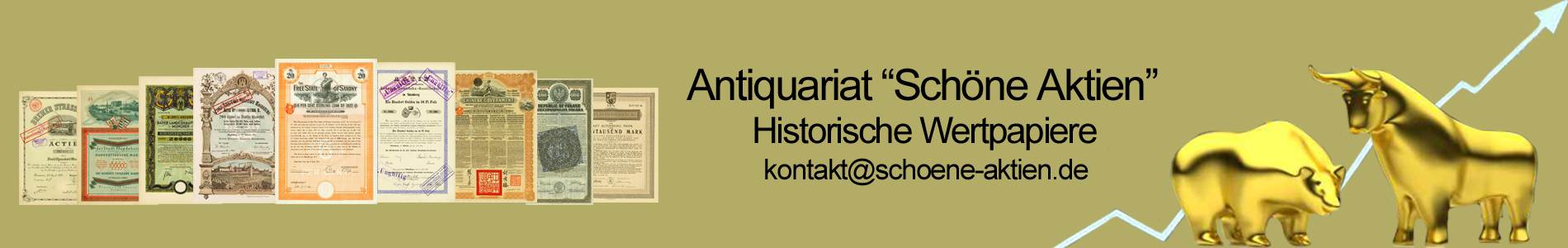| |
Schwarze Kohle, Weiße Kohle - Houille Bleue (Blaue Kohle)
|
Versuche für ein Gezeitenkraftwerk
|

Bestell-Nr. F19
 Preisliste
Preisliste
|
Die "Société Internationale pour l`Exploitation Industrielle de la Houille Bleue" (Internationale Gesellschaft zur industriellen Nutzung der "Blauen Kohle") unternahm in Frankreich von 1927 bis
1935 Versuche zur Nutzung von Gezeiten für die Energiegewinnung. Daraus resultierte dann 1966 die Inbetriebnahme eines
Gezeitenkraftwerkes in der Bretagne.
Die Energie der Gezeiten wird seitdem als "Blaue Kohle" (Houille Bleue) bezeichnet, im Gegensatz zu schwarzer Kohle
(Steinkohle) und weißer Kohle (Wasserkraft).
Nach dem Weltkrieg I führte der steigende Bedarf an Strom in Frankreich zu Forschungsprojekten zur alternativen
Stromerzeugung. Die Idee von Gezeitenkraftwerken wurde dabei auch untersucht. Gezeitenkraftwerke bestehen aus einer
Bucht, die durch einen Damm vom offenen Meer abgetrennt ist. In diesem Damm befinden sich die zur Stromerzeugung
genutzten Turbinen, die bei Flut von der Meerseite, bei Ebbe von der Buchtseite mit Wasser betrieben werden. Ab 1924
wurde in Frankreich das Projekt eines Gezeitenkraftwerkes in l`Aber Wrac`h (Finistère) erforscht. 1927 wurde als ein
weiteres Projekt die „Société Internationale pour l`Exploitation Industrielle de la Houille Bleue" gegründet. Diese
sollte die Chancen für die Nutzung der Gezeiten zur Energiegewinnung untersuchen.
Beide Projekte wurden 1935 aus Geldmangel eingestellt. Erst 1940 wurden die Untersuchungen durch den
französischen Ingenieur Robert Gibrat in der „Société d`études des usines marémotrice" weitergeführt,
jedoch kurz darauf durch die deutsche Besetzung Frankreichs unterbrochen.
|
Nach dem Weltkrieg II wurden die Pläne Gibrat`s für ein Gezeitenkraftwerk wieder aufgenommen und in der
Bretagne in der Mündung der Rance zwischen Dinard und St.Malo von 1960 bis 1966 verwirklicht.
Das vom Stromkonzern EDF betriebene Kraftwerk leistet mit 24 Turbinen 240 Megawattstunden.
Wasserkraft ist eine der ältesten Energiequellen der Menschheit. Schon seit über 2000 Jahre wird die Kraft von aufgestautem
oder fließendem Wasser genutzt, um Korn- und Sägemühlen oder Hammerschmieden zu betreiben.
Heute produzieren Wasserkraftwerke rund ein Fünftel des gesamten weltweiten Strombedarfs. Im Bereich der Nutzung von
Wellen und Meeresströmungen gibt es trotz großer Potenziale noch keine marktreife Stromerzeugungs-Technologie.
Wenn das Wort Gezeitenkraftwerk fällt, denkt man unweigerlich an das weltweit größte Projekt dieser Art,
das Strömungskraftwerk an der Mündung des französischen Flusses Rance bei Saint-Malo (Bretagne).
Bei diesem im Jahre 1966 errichteten Kraftwerk wird der Tidenhub von 12 bis 18 Meter genutzt, um Wasser hinter einem
Staudamm aufzustauen. Dabei werden 24 Röhrenturbinen à 10 MWel angetrieben. Bei Niedrigwasser wird das Wasser durch
diese Turbinen wieder abgelassen. Die durchschnittlich 2.200 Stunden pro Jahr in Betrieb befindliche Anlage ist jedoch
extrem korrosionsanfällig und hatte gravierende negative Auswirkungen auf das Ökosystem des Flusses. Der Betondamm ist
750 Meter lang wodurch ein Staubecken mit einer Oberfläche von 22 km² und hat einem Nutzinhalt von 184 Mio m³ entsteht.
Der Damm besitzt 24 Durchlässe, in denen jeweils eine Turbine mit einer Nennleistung von 10 MW installiert ist.
Die gesamte Anlage hat somit eine Leistung von 240 MW und erzeugt jährlich rund 600 Millionen Kilowattstunden Strom.
Dieses Kraftwerk arbeitet auch als Pumpspeicherwerk.
|
| | | Ein neuer Ansatz, die Gezeitenkräfte zu nutzen, stellt ein britisch-deutsches Projekt dar, welches seit einigen Jahren
in der Planung ist und 2005 im Bristol Channel vor der Küste Cornwalls installiert werden soll. Die Anlage, welche fast
wie eine "Unterwasser-Windkraftanlage" aussieht, nutzt nicht den Tidenhub, sondern die durch die Gezeiten verursachten
Meeresströmungen. Da die Dichte von Wasser deutlich größer ist als die von Luft, genügt auch das eher gemächliche Tempo von
Ebbe und Flut, um Strom zu gewinnen. Für eine erfolgreiche wirtschaftliche Nutzung müssen Strömungsgeschwindigkeiten
von 2 bis 2,5 m/sec vorhanden sein. Die Anlage erhielt den Namen "Seaflow". Bei der Seaflow-Pilotanlage wird ein Turm,
im Meeresboden verankert. Je nachdem wie tief der Meeresgrund bzw. die Strömung ist, wird ein Rotor mit einem
größeren Durchmesser oder zwei an einem Querbalken befindlichen kleinere Rotoren (rund 10 m Durchmesser) installiert.
Die Pilotanlage wird mit einem Rotor von 15 m Durchmesser ausgestattet. Damit sich die Rotorblätter immer unter der
Wasseroberfläche befinden, wird die Rotornabe rund zehn Meter unter dem Gezeiten-Tiefstand angeordnet. Die Versuchsanlage wird
3,6 Mill. Euro kosten und soll 350 KW leisten.
| | | Funktionsweise von Gezeitenkraftwerken:
Gezeitenkraftwerke werden an Meeresbuchten und in Ästuaren errichtet, die einen besonders hohen Tidenhub haben.
Dazu wird die entsprechende Bucht durch einen Deich abgetrennt. Dadurch kann das Wasser der Tidenströme nur durch die Turbinen
strömen. Da aufgrund von Flut und Ebbe die Gezeitenströme viermal am Tag die Richtung wechseln,
müssen die Turbinen auf Zweirichtungsbetrieb eingestellt sein. Bei Flut strömt das Wasser durch die Durchlässe des Dammes in
das Becken (die Meeresbucht). Die in den Durchlässen installierten Turbinen werden angetrieben. Bei Ebbe erfolgt der Antrieb
der Turbinen durch das abfließende Wasser. Zum Einsatz kommen sogenannte Rohrturbinen (Kaplan-Turbinen). Wird auf das
Speicherbecken verzichtet, dann kann der gesamte Tidenhub des Gezeitenwechsels genutzt werden.
Gezeitenkraftwerke entnehmen ihre Energie letztlich der Erddrehung, d.h., sie bremsen diese minimal ab.
Fordert man ein Minimum an Tidenhub von 5m, so gibt es ungefähr 100 geeignete Buchten auf der Erde, die für ein
Gezeitenkraftwerk genutzt werden könnten. Nur die Hälfte dieser ließe einen wirtschaftlichen Einsatz zu.
Da Ebbe und Flut alle 12 Stunden und 24 Minuten auftreten, kann die Leistung nicht gleichmässig abgegeben werden.
Verstärkt wird dies zudem durch hohe Spring- und schwache Nipptiden.
Die Gezeitenkraftwerke werden in Zukunft aufgrund der begrenzten möglichen Standorte nur einen sehr geringen Anteil
zur Strombedarfsdeckung leisten können.
| | | Kaplan-Turbine:
Die Kaplan-Turbine ist eine Axial-Wasserturbine, mit verstellbarem Laufrad. Sie wurde vom österreichischen Professor
Viktor Kaplan im Jahre 1913 aus der Francis-Turbine weiterentwickelt.
Das Laufrad gleicht bei der Kaplan-Turbine einem Schiffspropeller, dessen Flügel verstellbar sind. Turbinen ohne diese
Flügelverstellung werden als Propellerturbinen bezeichnet. Allerdings sollte für den Einsatz einer Propellerturbine eine
relativ konstante Wassermenge zur Verfügung stehen, da der Wirkungsgrad im Teillastbereich schnell abfällt. Das Wasser wird
durch eine Spirale in Drall versetzt und das Leitwerk, auch als Leitschaufeln bezeichnet, sorgt dafür, dass das Wasser parallel
zur Welle auf die Schaufeln trifft und dabei die Energie überträgt. Der Wasserdruck nimmt vom Entritt in das Laufrad bis
zum Austritt stetig ab. Die Kaplan-Turbine ist daher eine Überdruckturbine. Durch das Saugrohr verlässt das Wasser die Turbine.
Der Einbau der Turbine erfolgt meistens vertikal, so dass das Wasser von oben nach unten durchströmt.
Sie erreicht einen Wirkungsgrad von 80-95 %.
Durch die verstellbaren Laufradschaufeln kann die Kaplanturbine doppelt reguliert werden. Dadurch kann sie besser auf die
jeweilige Wassermenge und Fallhöhe eingestellt werden. Sie ist bestens geeignet für den Einsatz bei geringen Wasserdrücken
(also niedere bis niederste Fallhöhen) und großen Durchflussmengen. Sie ist damit prädestiniert für große Flusskraftwerke an
ruhig fließenden Großgewässern (Strömen).
| | | Erdrotation:
Die Erdrotation ist die Drehbewegung der Erde um ihre eigene Achse. Die Rotationsachse nennt man Erdachse.
Die Dauer einer Erdumdrehung ist nicht konstant, auch die Lage der Erdachse ändert sich täglich geringfügig.
Gründe dafür sind u.a. der unterschiedliche Wassergehalt der Atmosphäre und der Gewässer, die Drehimpulsaufnahme von
Stürmen und Meeresströmungen (auch durch Menschen verursacht bei großen Stauseen), Erdbeben und insbesondere die
Gezeitenreibung, welche zu einer durchschnittlichen Zunahme der Tageslänge um 16 µs pro Jahr führt. Man kann die
Veränderungen erst in letzter Zeit mit Hilfe von Ringlasern kontinuierlich verfolgen.
Die durchschnittliche Dauer einer Umdrehung nennt man Sternentag = 23 h 56 min 4,10 s.
Die Erddrehung kam – wie alle Planetendrehungen – einst zustande, als die heute feste Materie der Erde noch gasförmig war.
Jedes Gasteilchen hatte einen eigenen Drehimpuls. Diese Impulse zusammengenommen führten bei zunehmender
Abkühlung und Verdichtung des Gases schließlich zu einer einheitlichen Drehung des Gesamtkörpers. Je mehr sich der Gaskörper
durch weitere Abkühlung verdichtete, desto schneller begann er sich auch zu drehen.
Die Drehrichtung der Erde ist identisch mit der Umlaufsrichtung auf ihrer Bahn um die Sonne,
wie bei fast allen anderen Planeten auch. Lediglich die Venus dreht sich entgegengesetzt, und die Drehachse von
Uranus liegt nahezu in seiner Bahnebene.
|
|