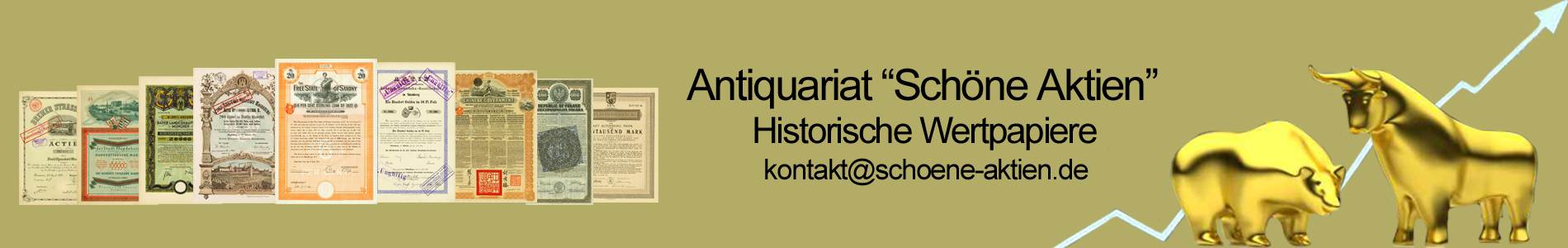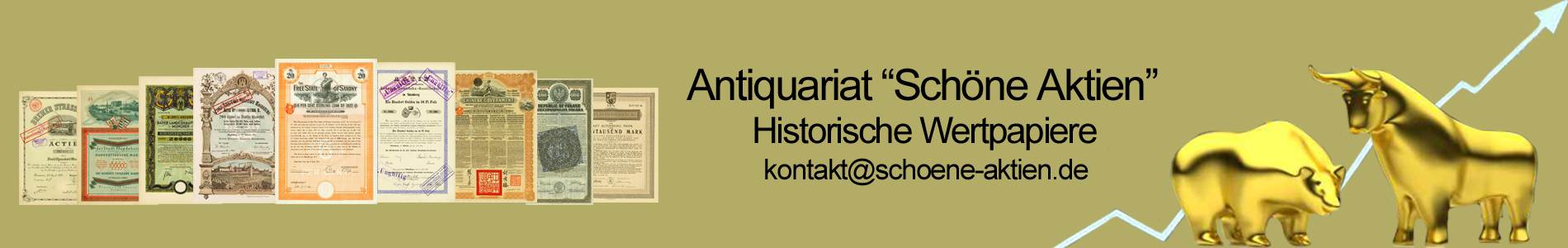| |
Hanomag
|
Die kräftigen Bullen
|
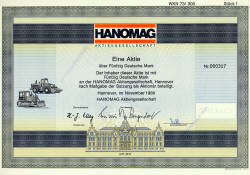
Bestell-Nr.: DM119f
 Preisliste
Preisliste |
Das Unternehmen wurde am 6. Juni 1835 von
Georg Egestorff in Linden, seit 1920 Hannover-Linden unter dem Namen
"Eisen-Giesserey und Maschinenfabrik Georg Egestorff" gegründet. 1868
wurde die Fabrik an Bethel Strousberg verkauft und 1871 von der neu
gegründeten "Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals Georg
Egestorff" übernommen. 1904 wurde durch Erich Metzeltin die
Telegraphenadresse aus Kostengründen auf Hanomag abgekürzt; seit 1912
wurde Hanomag dann auch als Briefadresse verwendet |
| Hanomag
gehörte über viele Jahrzehnte bis ca. 1920 zu den bedeutendsten
Lokomotivproduzenten in Deutschland. Die Fabrik von Georg Egestorff lieferte
bereits 1846 ihre erste Dampflokomotive "Ernst August", die den
Eröffnungszug der Hannoverschen Staatsbahn von Lehrte nach Hildesheim zog.
Sie gehörte damit zu den ersten Lokomotivfabriken in Deutschland. |
Nach Egestorffs
Tod 1868 erwarb der Bethel Strousberg das Werk in Linden. Strousberg erweiterte
die Produktionskapazitäten deutlich. In diese Zeit fällt der
Gleisanschluß an die Hannover-Altenbekener Eisenbahn, wodurch die
umständlichen Lokomotivtransporte auf Pferdewagen zum Staatsbahnhof
entfielen. Aufgrund von geplatzten Auslandsgeschäften musste Strousberg
die Fabrik bereits 1871 wieder verkaufen. Ein Bankenkonsortium gründete
daraufhin die "Hannoversche Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals Georg
Egestorff", die das Werk übernahm.
In den Folgejahren – das
Königreich Hannover war zwischenzeitlich von Preußen annektiert
worden – entwickelte und produzierte das Werk vor allem für die
Preußischen Staatseisenbahnen. Seit 1894 war Hanomag auch exklusiver
Lieferant der Oldenburgischen Staatsbahn. Ein wichtiges Standbein der Hanomag
war auch der Export: Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurden bereits etwa 40% der
Lokomotiven ins Ausland geliefert. |
1880 wurde eine
der ersten Motorlokomotiven der Welt als Prototyp gebaut. Nach Patentproblemen
gab man dies jedoch wieder auf und beschränkte sich weiterhin auf die
Herstellung von Dampfloks.
Nach einen Wechsel in der Direktion
kündigte sich 1922 eine Verschiebung im Produktionsspektrum der Hanomag
an, weg von der Lokomotivproduktion. Eine wesentliche Ursache für diese
Verschiebung war der stark gesunkene Bedarf an Lokomotiven nach der hohen
Kriegsproduktion im Ersten Weltkrieg. Nach 10.578 Lokomotiven stellte die
Hanomag am 29. Juni 1931 schließlich die Lokomotivproduktion ein. Das
Lokomotivgeschäft der Hanomag wurde an Henschel in Kassel
verkauft.
Unabhängig vom Lokomotivbau weitete die Hanomag die
Produktpalette aus: |
| Ab 1905 |
Produktion von LKW (bis 1977,
ab 1969 unter Hanomag-Henschel-Fahrzeugwerke GmbH unter zunächst
51-prozentiger, später 100-prozentiger Beteiligung der Daimler-Benz AG.
|
| Ab 1912 |
Produktion von Tragpflügen
mit bis zu 80 PS Benzolmotoren, ab 1924 erster Traktor mit Benzolmotor, 1931
erster Dieselschlepper mit 4-Zylindermotor. Hanomag war 1939 und Anfang der
1950er Jahre Marktführer. 1953 folgte eine teilweise Umstellung auf 2-Takt
Dieselmotoren. Diese Motoren waren aber nicht ausgereift und wenig standfest.
Dies hatte einen massiven Einbruch der Verkaufszahlen zur Folge. Seit 1962
wurden nur noch 4-Takt Dieselschlepper gebaut bis zur Einstellung der
Produktion 1971. |
| Ab 1924 |
Produktion von Personenwagen
(bis 1941), Ein Neuanfang blieb 1951 im Prototypstadium stecken). |
| Ab 1931: |
Produktion von Baumaschinen.
|
Die bekanntesten
Maschinen der Hanomag sind heute die Traktoren. Von 1912 bis 1971
verließen mehr als 250.000 Maschinen von 12 - 92 PS die Werkshallen.
1969 fusionierten innerhalb des Rheinstahl-Konzerns die Nutzfahrzeug-Sparten
von Hanomag und den Henschel-Werken zur "Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke
GmbH" (HHF), an der sich Daimler-Benz beteiligte und diese bis 1971 komplett
übernahm.
In den 70er Jahren übernahm der damalige deutsche
Wirtschaftsmanager Horst-Dieter Esch die Hanomag und gliederte sie,
neben vielen anderen Baumaschinenfirmen, in seine IBH-Holding ein, um den
größten Baumaschinenkonzern der Welt zu formen. Die IBH endete im
Konkurs. Esch wurde im März 1984 verhaftet und im Oktober des gleichen
Jahres vom Landgericht Koblenz wegen Betrugs in Tateinheit mit
Konkursverschleppung zu sechseinhalb Jahren Haft und 90.000 DM (46.000 Euro)
Geldstrafe verurteilt.
1989 stieg der japanische Baumaschinenhersteller
Komatsu bei der stark angeschlagenen Hanomag ein. 1995 wurde der Betrieb
in Hanomag Komatsu AG umbenannt und produziert bis heute in Hannover
Baumaschinen, die jedoch statt "Hanomag" nur noch die Aufschrift "Komatsu"
tragen. |
Hanomag produzierte in den 1920er
Jahren einen revolutionären Kleinwagen, der auf dem Fließband
entstand. Aber auch der Hanomag 2/10 PS Kleinwagen wurde hergestellt
("Kommissbrot"). Der Einzylinder-Viertaktmotor mit 499 ccm Hubraum saß im
Heck und trieb über eine im Ölbad schwimmende Kette die
Hinterräder ohne Differential an. Damit erreichte der Wagen eine
Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h. Der nur 370 kg schwere Zweisitzer war so
schmal, dass man auf 2 Scheinwerfer verzichten konnte (erst ab 1931 schrieb
eine Gesetzesänderung die Umrüstung auf zwei Scheinwerfer vor). Die
sonst üblichen Kotflügel und Trittbretter fehlten. Aus Gründen
der Stabilität hatte das rechtsgelenkte "Kommissbrot" nur auf der linken
Seite eine Tür. Bis 1928 wurden fast 16.000 Stück produziert. Der
Kaufpreis lag bei 2.000 - 2.500 Reichsmark. Obgleich das Fahrzeug von der
Konzeption her eine gebrauchsfähige Lösung des Kleinwagenproblems
darstellte, neigte die Käuferschaft eher zu teureren "richtigen" Autos,
wie dem Dixi oder dem Opel Laubfrosch, zumal die Unwucht des stehenden
Heckmotors das Auto im Leerlauf in eine unangenehme hüpfende Bewegung
versetzte. Redewendung: Ein bißchen Blech, ein bißchen Lack, und
fertig ist der Hanomag!
Hanomag präsentierte 1928 den wesentlich
komfortableren und leistungsfähigeren Nachfolger mit 745 ccm
Vierzylindermotor mit 16 PS Leistung. Über ein angeblocktes
Dreiganggetriebe wurden die Hinterräder, immer noch ohne Differential,
angetrieben. Die Karosserie bestand aus mit Stahlblech verkleidetem
Hartholzgerippe. Zunächst nur als schmuckes Cabrio mit Notsitz vertrieben,
kam im Winter 1929/30 die Limousine mit stärkerem Motor dazu. |
| 1934 brachte Hanomag mit dem "Rekord"
sein erstes 1,5-Liter Mittelklasse-Automobil auf den Markt. Die
Ganzstahlkarosserie in der Jupiter-Form blieb bis 1938 das wichtigste Modell im
Verkaufsprogramm. Ab 1937 gab es den Rekord mit Lochscheibenrädern,
Stromlinienheck und etwas höherer Leistung. 1936 stellte Hanomag den
"Rekord Diesel" mit 1.910 ccm vor. Zeitgleich mit dem Mercedes-Benz 260 D
gehörte er zu den ersten Serien-PKW mit Dieselmotor. |
| Auf der Frankfurter IAA 1951 stellte
Hanomag den "Partner" vor, mit dem die Rückkehr auf den Markt
für PKW versucht wurde. Zwar war der Wagen in bezug auf Design und Technik
auf der Höhe seiner Zeit (Dreizylinder-Zweitaktmotor mit 28 PS aus knapp
700 ccm Hubraum, 100 km/h Spitze, 3 Sitze vorn, zwei Notsitze für Kinder
hinten), fand aber beim Publikum so wenig Anklang, dass er nicht in Serie ging.
|
|