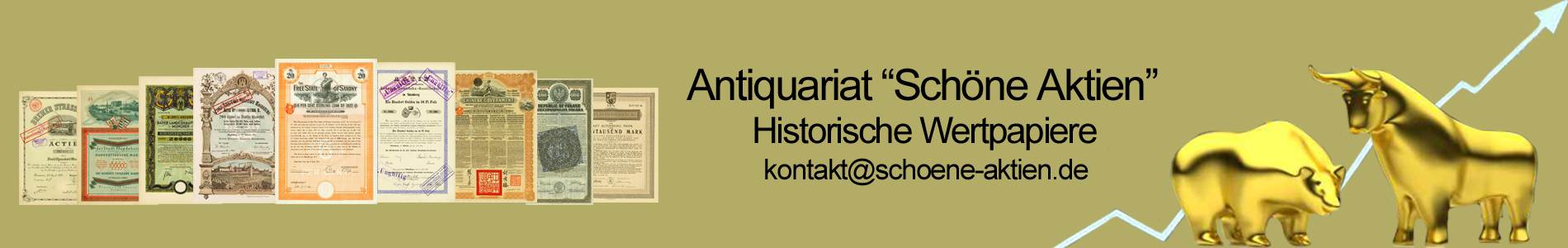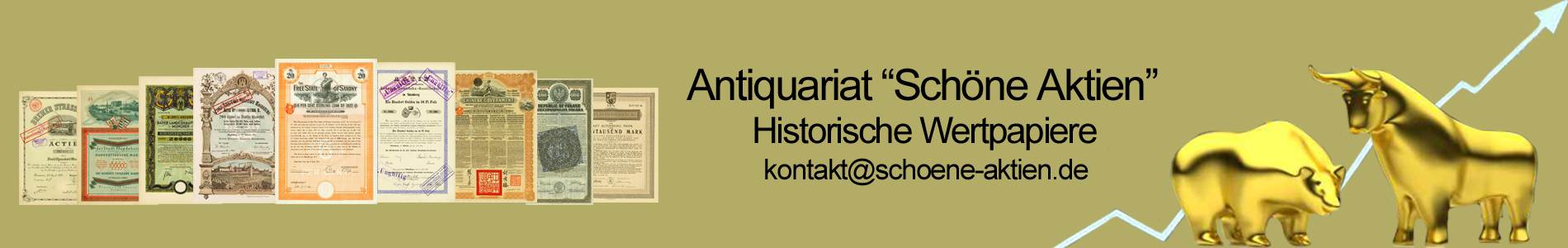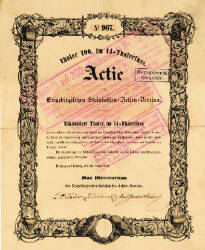
Bestell-Nr.: D158
Gründer-Aktie, 1846, Auflage nur
2400 Stk.
 Preisliste
Preisliste
Orginalunterschrift von Carl Gustav Harkort, Besitzer
eines grossen Handelshauses in Leipzig
Landtagsabgeordneter,1834 Direktor
der Leipzig-Dresdner Eisenbahn (für 30 Jahre !)
Mitbegründer der
ADAC
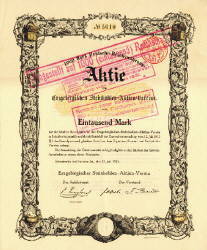
Bestell-Nr.: D11
 Preisliste Preisliste
|
Bilder und Texte wurden mit
freundlicher Genehmigung von Uwe Schickedanz veröffentlicht.
Besuchen
Sie doch einmal seine Homepage.
Im
Erzgebirge, einer Mittelgebirgslandschaft direkt an der Grenze zu Tschechien,
zwischen dem bayrischen Hof und dem sächsischen Dresden, gab es schon
lange Bergbau. Erz wurde abgebaut - wie der Name des Gebirges auch aussagt.
Aber es wurde auch Kohle und nach dem Weltkrieg II sogar Uranerz durch die
russischen Besatzer abgebaut. Zentrum des Bergbaus war die Stadt Zwickau.
Das Zwickauer Steinkohlenrevier lag unterhalb der Stadt, sowie südlich und
südöstlich, besonders unter den Ortschaften Bockwa, Cainsdorf,
Oberhohndorf, Planitz und Schedewitz. Geologisch gehörten die
Steinkohlenlagerstätten zum Erzgebirgischen Becken. Abbauwürdige
Flöze befanden sich nur in Lugan-Oelsnitz und Zwickau. Das Zwickauer
Revier erstreckte sich über 30 qkm.
Die Steinkohle fand in Sachsen
anfangs nur wenig Bedeutung, da das Erzgebirge reich an Holz war. Ab dem 16.
Jhd. setzten die Schmiede aber verstärkt Steinkohle ein - denn die
erhielten gemäß einer Verordnung von 1557 einen Preisnachlaß
von 10%. Von 1640 - 1739 waren die Kohlebergwerksbesitzer in einer Zwangsinnung
zusammengeschlossen. Die achtete auf Beilegung von Konkurrenzstreitigkeiten und
Einhaltung des Mindestpreises.
Ein Gesetz des Kurfürsten vom 18.8.1743
sah vor, daß Grundstückseigentümer, die ihre Kohle nicht selbst
abbauten, nach Ablauf eines Jahres das Abbauen anderen Interessenten gestatten
mußten.
Mit der Erfindung der Dampfmaschine brach das
Steinkohlenzeitalter an.
Der ESTAV wurde am 19.2.1840 mit 2400 Aktien
gegründet und nach der durch den Sachsenkönig Friedrich August II in
1892 initiierten Einführung des GmbH-Gesetzes als Kapitalgesellschaft
weitergeführt. Der ESTAV war das führende sächsische Bergbau-
und Kohleveredlungs Unternehmen.Der Aufschwung kam mit dem Bau des
Gleisanschlusses an die Eisenbahnstrecke Zwickau-Werdau für den "Segen
Gottes Schacht". Die ersten Züge rollten am 13. Dezember 1847. Dies war
der erste Gleisanschluss eines sächsischen Bergbaubetriebes
überhaupt. In den ersten beiden Jahren des Gleisanschlusses wurden 2199
Wagen Kohle verladen, 10 Jahre später (1858) waren es schon 6472
Eisenbahnwagen pro Jahr. Der Eisenbahnanschluss war auch für andere
Betriebe interessant. So beteiligten sich u.a. das Röhrenwerk Paul
Richter, die Ziegelei Franz Wolf und die Ziegelei Emil Selbmann am
Eisenbahnanschluss. Mit dem Wachstum des Bergbaus wuchs auch die Stadt Zwickau
selbst. Bisher wurde die Kohle auf Pferdewagen verladen und Kunden waren somit
nur in der näheren Umgebung zu finden. Mit der Eisenbahn konnte die Kohle
nun auch über weite Entfernungen transportiert werden. Das brachte den
Aufschwung.
Die Nutzung der Steinkohle geht bis in das 11.Jahrhundert
zurück. Nachgewiesen waren deren negitive Folgen - so verbot das Zwickauer
Stadtrecht die Verwendung von Kohle für Schmiedefeuer wegen
"Luftverpestung". Der erste offizielle Kohleabbau erfolgte 1493.
Die Kohle
lag nur knapp unter der Erde - "Kohlebauern" bauten sie ab. Erst mit der
Erfindung der Dampfmaschine ging es richtig los. 1820 wurden ca. 6 000 t und
1871 bereits über 2 000 000 t Kohle gefördert. Ein Großteil der
Kohle wurde zu Koks weiterveredelt - Das Brennmaterial für Hochöfen
zur Stahlgewinnung. In Zwickau wurde 1830 zum ersten Male Koks gebrannt.
Der Bergkommissionsrat Amandus Kühn und der Freiberger Professor
Breithaupt stellten einen Antrag auf Genehmigung für Bohrversuche auf dem
städtischen Grundstücken in Planitz. Der Stadtrat von Zwickau lehnte
ab und gründete selbst - unter Einbeziehung reicher Bürger - am
30.10.1837 den "Zwickauer Steinkohlenbau-Verein".
Kühn und Breithaupt
gaben aber nicht auf. Sie wurden 1838 fündig - das Ludwigsflöz und
das Segen-Gottes-Flöz wurden entdeckt. Beide gründeten daraufhin am
3.2.1840 den "Erzgebirgischen Steinkohlen-Actien-Verein". Es wurden 2.400
Aktien zu je 100 Thalern ausgegeben. Der erste Spatenstich am
"Segen-Gottes-Schacht" in Marienbad erfolgte am 20.12.1841. Der Schacht wurde
1845 bis auf 312 m Tiefe vorgetrieben. Die Gesellschaft bohrte auch in Zwickau
und drang 1880 bis auf 640 m Tiefe vor. |
| |
|
In Schedewitz
wurde 1844 der "Hoffnungsschacht" (313 m) und 1866 der "Vertrauensschacht" (385
m) vorgetrieben. Nach 1900 erstreckte sich das Grubenfeld des ESTAV auf
Zwickau, Marenthal, Schedewitz, Oberhohndorf, Brockwa und Planitz. Während
im Ruhrgebiet schon längst Kokerein standen, baute die Gesellschaft erst
1916 ihre ersten Koksöfen. Der "Segen-Gottes-Schacht" wurde 1918 wegen
Erschöpfung geschlossen, auch die Ergebiegkeit der anderen Gruben
ließ nach. Es wurde versucht durch Fusion mit anderen Bergwerken zu
größeren und damit rentableren Einheiten zu kommen. 1921 pachtete
die Gesellschaft Gruben des "Zwickauer Steinkohlenbauvereins". Die Gesellschaft
hatte gegenüber den ergiebigen Gruben im Ruhrgebiet und Oberschlesien auch
wirtschaftliche Nachteile. Die Verwerfungen der Kohlenflöze war groß
und die Mächtigkeit schwankte stark. So mußte wesentlich mehr
Grubenholz zur Sicherung der Gruben gekauft werden. Außerdem mußte
noch der Zehnte bezahlt werden. So zahlte die Gesellschaft bis 1927 bei 26
Millionen Mark Dividende einen Betrag von 15.4 Millionen Mark als "Zehnten". Um
die wirtschaftliche Situation zu verbessern, schloßen sich die
Steinkohlewerke 1919 zum "Sächsischen Steinkohlensyndikat" zusammen. Gegen
Ende der 1930er Jahre gereit die Gesellschaft in Schwierigkeiten. Erst nach
einer großen Sanierung konnte 1937 ein ausgeglichener
Jahresabschluß vorgelegt werden. In dieser Zeit betrug die
Mitarbeiterzahl ca. 5.000. Das Aktienkapital betrug 2.4 Millionen RM und war
verteilt auf 6.000 Aktien zu 20 RM und 2.280 Aktien zu 1.000 RM. Die Aktien
wurden bis 1932 an der Leipziger und Zwickauer Börse gehandelt.
Verglichen mit dem Ruhrgebiet und Oberschlesien hatte der sächsische
Steinkohlenbergbau nur eine deutlich geringere Wirtschaftskraft. Der gesamte
sächsische Bergbau beschäftigte ca. 25.000 Arbeitskräfte und
förderte jährlich 5 Millionen t Steinkohle. Die preußischen
Bergwerke beschäftigten 224.000 Arbeitskräfte und förderten
jährlich 153.3 Millionen t. Erst nach dem Weltkrieg I erlangten sie
größere Bedeutung, da die oberschlesischen Bergwerke vom Reich
abgetrennt wurden, das Ruhrgebiet besetzt wurde und Deutschland ein
Kohlentribut an die Siegermächte zahlen mußte. |
| |
Die gesamte
Gleislänge auf dem Zwickauer Bahnhof betrug 4250 m, davon waren 2270 m
für die Kohleverladung reserviert. Allerdings ganz ohne Pferde ging es
noch nicht. Die Kohle aus den Schächten wurde auf Pferdegespanne verladen
und dann zum Bahnhof gefahren und auf die Waggons verladen.
Nach dem dieser
Gleisanschluss so erfolgreich war, bauten auch andere Kohlezechen einen solchen
Anschluss. So wurde ein Gleis nach Bockwa gelegt. An dieses schlossen sich an:
der Erzgebirgische Steinkohlenbergauverein mit dem "Hoffnungsschacht" und dem
"Vertrauensschacht", die Arnimschen Steinkohlenwerke mit dem "Auroraschacht"
und dem "Vereinsglücksschacht" und die "Königin Marien Hütte" in
Cainsdorf. |
| |
Insgesamt wurden
so 50 Kohlenzüge (in welchem Zeitraum ist mir nicht bekannt) auf dem
Zwickauer Bahnhof abgefertigt.
Der "Segen Gottes Schacht" stellte 1919 die
Förderung ein. Aber die anderen Anlieger benutzten den Anschluss weiter.
Da der Eisenbahnverkehr generell ständig wuchs, baute die Deutsche
Reichsbahn einen neuen Bahnhof in Zwickau. Der alte Anschluss für die
Kohlegruben wurde stillgelegt und ein anderer gebaut. |
| |
Das Erzgebirge im
Grenzgebiet zur Tschechischen Republik.
Die Steinkohlenflöze stammen
aus der Karbonzeit - und wurden durch Zufall im Jahre 1831 gefunden. 1844 wurde
die erste Kohle durch den Zwickauer Bergfaktor Karl Gottlob Wolf
gefördert. Er brauchte nur 9 m tief zu graben. Damit wurde das Erzgebirge
zum Kohlenrevier. Der erste Abbau erfolgte durch Privatpersonen: Grundbesitzer
und kleine Gesellschaften. Erst um 1855 wurden richtige Bergbaugesellschaften
gegründet. Die Hauptgründerzeit war um 1870. Von nun an wurden auch
tiefe Schächte gebaut - zum Teil bis 1000 m.
Im rechten Bild sind die
Kohlegruben um Zwickau aufgeführt:
- Nr 1 = Schacht 407 Schmirchau
- Nr. 2 = Schacht 403 Drosen
- Nr. 3 = Martin Hoop
- Nr. 4 = Karl
Liebknecht Schacht
- Nr. 5 = Aue
- Nr. 6 = Ehrenfriedersdorf
- Nr.
7 = Freiberg
- Nr. 8 = Willi Agatz
- Nr. 9 = Königsstein
-
Nr.10 = Altenberg |
| |
| Von den
vorhandenen Schächten dienten von vier zur Wetterführung
(Luftaustausch). Für die Durchlüftung und Abfuhr verbrauchter Luft
und schlechter Gase wurde pro Wetterschacht ein grosser Ventilator eingesetzt.
Sein Durchsatz betrug 9 000 cbm Luft pro Minute. Das Wasser in den
Schächten wurde mit 110 Pumpen abgepumpt - 4 cbm pro Minute. |
| |
|
| Einiges zur Geschichte und
den Bränden der Kohlenflöze |
| 1348 |
In den "Zwickauer
Schmiedeartikeln" wurde festgelegt, dass zum Schmieden wegen der Feuergefahr
keine Kohle innerhalb der Stadtgrenzen verwendet werden durfte. |
| 1476 |
In diesem Jahre
wird zum ersten Male der Kohlenbrand erwähnt. Er soll der Legende nach
durch einen Gewehrschuß in einen Fuchsgang ausgelöst wurden sein.
|
| 1499 |
Kurfürst
Friedrich erwähnte zum ersten Male den Abbau der Kohle. Dieser erfolgte im
Tagebau, später in brunnenartigen Schächten bis 40 m Tiefe. |
| 1500 |
Georgius Agricola
(1494-1555) untersuchte die Kohlenflöze im Zwickauer Gebiet und
erwähnte auch die bereits damals schon brennenden Steinkohlenflöze.
|
| 1520 |
Der Kohleverkauf
wurde geregelt - auch wer zuerst verkaufen durfte.
Georgius Agricola
berichtet über den Kohlebrand. |
| 1530 |
Es gibt erste
Aufzeichnungen über das unterirdische Feuer von Planitz/Zwickau. Damals
trat Rauch aus Höhlen aus - das Feuer brannte bis etwa Ende 1900.
Die
Kohlenflöze gingen schräg in den Boden und brannten von Oben nach
Unten. |
| 1534 |
Die erste
Zwickauer Kohlenabbau-Gesellschaft (Gewerkschaft) wird gegründet. |
| 1641 |
Im Mai
rückten die protestantischen Schweden während des 30-jährigen
Krieges in Zwickau ein, raubten und vergewaltigten was sie konnten. Die
Einwohner versteckten sich und ihr Hab und Gut in den Kohleschächten. Die
Schweden erfuhren dies, fanden aber nichts und zündeten die
Bergwerksgebäude an. Daraufhin fingen die Kohlenflöze wieder an zu
brennen. |
| 1668 |
Bis 1675 brannten
die Kohlenflöze sehr stark. Deshalb wurde ein Löschkonsortium
gegründet. Der Planitzer Bach wurde in die Schächte geleitet. Der
Brand wurde so fast gelöscht - er brach aber 1679 wiederum aus. |
| 1758 |
Da die
Kohlenflöze unterirdisch immer noch brannten, wurde ein spezieller
Feueraufseher eingestellt. |
| 1802 |
Das Schneeberger
Bergamt stellte fest, daß bereits 3 Kohlenflöze brannten. Darufhin
wurden 1816 die Schächte zugeschüttet um die Sauerstoffzufuhr zu
unterbinden. Die Schächte blieben ca. 6 Jahre zu. Beim Öffnen danach
brach das Feuer wieder aus.
Die Hitze war so gross, daß selbt bei
hohem Frost die Wiesen grün blieben. Im Sommer stieg die Temperatur der
entweichenden Gase auf 100 Grd.
Dr. E. A. Geitner gründete auf diesen
warmen Boden 1837 eine Gärtnerei mit 9 Treibhäusern und züchtete
Tropenpflanzen - Ananas, Bananen etc. Seine blühende Riesen-Seerose
"Victoria Regia" wurde weltweit bekannt. Geitner bot in seinem Katalog 1500
Pflanzen zum Kauf. |
| 1820 |
Die wegen des
Brandes zugeschütteten Schächte werden wieder geöffnet -
daraufhin bricht das Feuer wieder aus und die Schächte werden wiederum
zugeschüttet. |
| 1830 |
Der erste
Zwickauer Koks wurde im königlichen Steinkohlenwerk "Junger Wolfgang"
gebrannt. |
| 1841 |
Bis 1845 wird der
"Segen-Gottes-Schacht" in Marienthal in einer Tiefe von 312 m vorangetrieben.
|
| 1842 |
Die
Königin-Marien-Hütte in Cainsdorf produziert zum ersten Male Eisen -
sieben Jahre vor dem Bau von Hochöfen im Ruhrgebiet.
Die Hütte
lieferte auch den Stahl für das "Blaue Wunder" in Dresden. |
| 1845 |
Bis 1851 wird der
"Hoffnung-Schacht" in Schedewitz in einer Tiefe von 312 m vorangetrieben. |
| 1846 |
Die ESTAV
errichtete die erste eigene Kokerei.
Zur Geldbeschaffung gibt die ESTAV
mehrere Anleihen heraus:
1846: Anleihe über 432 000,00 Mark
1852:
Anleihe über 600 000,00 Mark
1863: Anleihe über 510 000,00 Mark
|
| 1855 |
Der "Vertrauenschacht" der ESTAV wurde zwischen 1855 -
1861 gebaut (geteuft). Der Schacht ging bis auf 400 m Tiefe. Im Dritten Reich
wurde der Kohleabbau so stark forciert, so dass der Schacht 1948 teilweise
einstürzte.
Das Bild zeigt die Anlage vor dem Weltkrieg I. |
| 1859 |
Der bestehende Alexanderschacht mit einer Tiefe von 243 m
wird noch mehr vertieft. Die Herren "von Arnim" werden damit zu
"Montanunternehmern". |
| 1860 |
Mit neuen Methoden gelang es das Feuer zu löschen.
Aber die Gärtnerei ging dabei Pleite - machte aber erst 1882 dicht. |
| 1865 |
Es gab 66 Kohlegruben |
| 1873 |
Die ESTAV kaufte den "Himmelfürstschacht" des
Steinkohlenbauvereins in Niederplanitz, der durch den Bergfaktor Weber 1847
gegründet wurde.
Der Schacht hatte eine Tiefe von 175 m und
förderte 11 500 t Kohle bereits im ersten Jahr. Der Schacht brannte aber
stark und wurde deshalb an die ESTAV verkauft. Die ließ alles zumauern
und wartete erstmal ab. |
| 1875 |
Zur Erweiterung werden zwei Tiefbauschächte bis auf
640 m Tiefe niedergebracht. Der Betrieb auf der Tiefe von 590 m begann 1900.
|
| 1885 |
Die ESTAV übernahm die Schächte "Günther"
und "Fortuna". |
| 1900 |
Der
Grubenpferdebetrieb wurde durch mit Pressluft betriebene Seilbahnen
abgelöst. Ausserdem wurde viel öfters gesprengt. Der Boom in der
Eisen- und Stahlindustrie führte auch zu einem grossen Zuwachs der
Schacht- und Kokereianlagen der ESTAV.
Die erste Turmfördermaschine
Deutschlands wird auf dem Alexanderschacht errichtet. |
| 1901 |
Der
"Himmelfürstschacht" wurde wieder geöffnet. Aber die Grube brannte
weiter. Der unterirdische Brand war so stark, dass die Arbeiten 1912
eingestellt werden mussten. |
| 1913 |
Das Kraftwerk der
ESTAV liefert nun auch Strom für die Stadt Zwickau. |
| 1920 |
Der Aktienverein
"Zwickauer Bürgerschacht" wird übernommen |
| 1921 |
Der "Zwickauer
Steinkohlenbau-Verein" wird übernommen |
| 1946 |
In einem
"Volksentscheid" enteignet das Land Sachsen alle Steinkohlenbetriebe; Zwischen
1945 und 1946 bestand die Firmenleitung aus sowjetischen Offizieren. |
| 1949 |
Der 1855 gebaute
Vertrauenschacht belieferte vorallem die Kokerei. Die Ausbeutung durch die
sowjetischen Besatzer und das knappe Geld des DDR-Staates liess eine Unmenge
von ungefilterten Kokereiabgasen in die Luft - eine furchtbare
Umweltverschmutzung entstand. |
| 1975 |
Die eigene
Steinkohle in den Zwickauer Gruben war aufgebraucht. Aber die DDR-Industrie
brauchte weiterhin viel Koks. Deshalb wurde Steinkohle aus der Sowjetunion,
Polen und CSSR importiert, damit die Planzahlen für 550 000 t Koks
gehalten werden konnten. Dieser Ausstoß führte zu einem
grässlichen Dreck über Zwickau. Denn die DDR hatte kein Geld zum Kauf
von Entschwefelungsanlagen. Es gab oftmals Smogalarm - er wurde aber aus
politischen Gründen kaum ausgerufen. |
| 1992 |
Am 18. März erfolgte der
letzte Koksabstich. Mit der Wiedervereinigung wurde auch die Zwickauer Luft
reiner. |
| 1995 |
In diesem Jahr kam
das Aus für 313 Mitarbeiter. |